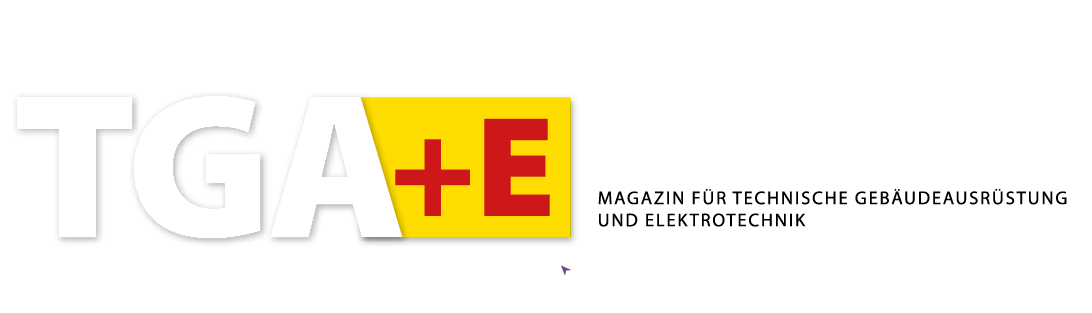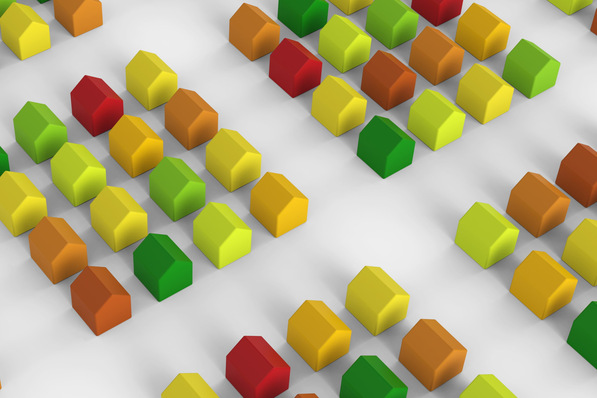Der Artikel kompakt zusammengefasst
■ Der Technischen Gebäudeausrüstung kommt eine zentrale Rolle für Ressourceneffizienz, Betriebssicherheit und Nachhaltigkeit in der Trinkwasserversorgung zu.
■ Wichtige Elemente dafür sind hohe technische Standards, das Regelwerk, die Zertifizierung von Handwerk und Produkten sowie ein konsequent umgesetzter Qualitätsanspruch.
■ Häufig sind es nicht komplexe High-End-Technologien, sondern robuste, praxisgerechte Lösungen, die im Zusammenspiel mit einer fachgerechten Planung, Installation und Integration in ein abgestimmtes Gesamtkonzept wirken.

Hans Sasserath
Warum Normen, allgemein anerkannte Regeln der Technik, qualifizierte Fachplanung und hochwertige Komponenten entscheidend für eine nachhaltige Trinkwasserversorgung sind.
Der effiziente und verantwortungsvolle Umgang mit Trinkwasser ist für die Technische Gebäudeausrüstung nicht nur eine „normale“ Anforderung, sondern gleichzeitig eine zentrale Herausforderung. Klimawandel und Urbanisierung führen zu einer steigenden Belastung der verfügbaren Wasserressourcen. In großvolumigen Gebäuden, etwa Bürokomplexen, Hotels oder Krankenhäusern, haben die Endnutzer in der Regel keinen direkten Einfluss auf den spezifischen Wasserverbrauch oder die Vermeidung von Wasserverlusten. Die Verantwortung für einen ressourcenschonenden und sicheren Betrieb liegt deshalb maßgeblich bei Fachplanern, Betreibern und Facility-Managern.
Technische Komponenten wie Filtrationssysteme, Druckregelarmaturen und Systeme zur Leckageerkennung sind zentrale Elemente, um ungewollte sowie nicht erkennbare Wasserverluste zu minimieren, Betriebssicherheit zu gewährleisten und hygienische Anforderungen zu erfüllen. Deutschland gilt in diesem Bereich als führend: Seit Ende der 1940er-Jahre wird kontinuierlich in die Modernisierung der Wasserinfrastruktur investiert. Ein wesentlicher Meilenstein war die Einführung des DVGW-Arbeitsblatts W 392 im Jahr 2003 (zuletzt aktualisiert: September 2017). Es definiert konkrete Verfahren zur Leckageüberwachung sowie zur hydraulischen Netzoptimierung bei Wassertransport und -verteilung. Das dort beschriebene strukturierte Vorgehen – bestehend aus regelmäßiger Inspektion, gezielter Wartung und planmäßiger Erneuerung – lässt sich unmittelbar auf die gebäudeseitige Trinkwasserversorgung übertragen.
Versorgungslage in Deutschland – Rahmenbedingungen für Gebäude

Hans Sasserath
Deutschland verfügt mit jährlich mehr als 188 Mrd. m3 erneuerbaren Wasserressourcen über vergleichsweise umfangreiche Reserven. Der tatsächliche Verbrauch liegt bei maximal etwa 15 % dieser Menge. Dennoch ist die Minimierung von Wasserverlusten ein wesentlicher Aspekt der Technischen Gebäudeausrüstung. Dies gilt nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch aufgrund der Kostenstruktur: Laut Wasserpreisvergleich 2024 des Bundesverbands der Energie-Abnehmer (VEA) liegen die durchschnittlichen Preise für Trinkwasser bei rund 2,00 Euro/m3 und für Abwasser bei 2,50…5,00 Euro/m3.
Diese im internationalen Kontext vergleichsweise hohen Preise reflektieren die hohe Versorgungssicherheit, die ausgezeichnete Wasserqualität sowie den hohen technischen Standard der Infrastruktur. Die Akzeptanz bei Endverbrauchern ist entsprechend hoch: Laut Kundenbarometer Wasser/Abwasser 2025 des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bewerten rund 75 % der Befragten das Preis-Leistungs-Verhältnis der Wasserversorgung als sehr gut, gut oder angemessen. Für Abwasserbetriebe liegt dieser Wert bei etwa 60 %.
Die Qualitätsanforderungen an Trinkwasser in Deutschland sind hoch. Und sie werden erfüllt: Kontinuierlich liegen über 99 % aller geprüften Parameter deutlich unterhalb der zulässigen Grenzwerte. Charakteristisch ist zudem, dass – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern – dem Trinkwasser kein Chlor zur Desinfektion zugesetzt wird. Dies trägt dazu bei, dass Leitungswasser in Deutschland häufig eine höhere sensorische und hygienische Qualität aufweist als abgefülltes Mineral- oder Tafelwasser.
Vor diesen Hintergründen ist die Minimierung von Wasserverlusten ein zentrales Ziel. Mit einem Anteil von rund 6 % liegt Deutschland laut BDEW-Daten (Stand März 2025) im internationalen Vergleich auf einem sehr niedrigen Niveau. Einen maßgeblichen Beitrag zu dieser Entwicklung leistete die Einführung des DVGW-Arbeitsblatts W 392. Was für öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen gilt und sich bewährt hat, lässt sich auf die Hausinstallation übertragen:
Neben einer sachgerechten Instandhaltung sind insbesondere die Qualität der Planung und die fachgerechte Bauausführung entscheidend für einen wirtschaftlichen Betrieb und eine lange Lebensdauer der Wasserversorgungsanlagen.
Schlüsselfaktor Ausführungsqualität
In Deutschland ist die eigenverantwortliche Ausführung von Sanitär- und Heizungsinstallationen ausschließlich autorisierten- und konzessionierten Fachbetrieben vorbehalten. Grundlage hierfür ist ein etabliertes und strukturiertes Ausbildungssystem, das ein hohes Qualifikationsniveau sicherstellt.
Dennoch können fehlerhafte Installationen oder der Einsatz qualitativ minderwertiger Komponenten zu erheblichen Wasserverlusten und Folgeschäden führen. Besonders kritisch ist, dass Versicherungsleistungen im Schadensfall entfallen können, wenn nicht zugelassene oder für den Anwendungsfall ungeeignete Produkte verbaut wurden – auch wenn diese im freien Handel erhältlich sind. Nur Produkte mit dem ZVSHK-Qualitätszeichen oder einer DVGW-Zertifizierung gewährleisten höchste Qualitätsstandards und bieten geprüfte Sicherheit in Planung, Einbau und Betrieb.
Zahlreiche Wasserversorgungsunternehmen führen zudem ein Installateurverzeichnis, in das ausschließlich geprüfte und qualifizierte Fachfirmen aufgenommen werden. Für Planer, Betreiber und Facility Manager bieten diese Verzeichnisse eine verlässliche Grundlage zur Auswahl fachlich geeigneter Betriebe. Dadurch lässt sich das Risiko von Planungs- und Ausführungsfehlern signifikant reduzieren.

Hans Sasserath
Herausforderungen in Großgebäuden
Neben der Qualität der Ausführung stehen Facility-Manager großer Liegenschaften vor weiteren betrieblichen Herausforderungen. Im Gegensatz zu Ein- oder Mehrfamilienhäusern verfügen Großgebäude über komplexe hydraulische Versorgungsnetze, die sich über mehrere Etagen oder sogar über mehrere Gebäudeteile erstrecken. Dies erschwert die präzise Lokalisierung von Leckagen und führt zu einer erhöhten Anfälligkeit für Druckschwankungen. Bereits kleine Undichtigkeiten können aufgrund zentral gelegener Technikräume Auswirkungen auf ganze Versorgungsbereiche haben.
Hinzu kommt, dass schwankende Auslastungen – etwa in Hotels, Messezentren oder Veranstaltungsstätten – zu Stagnationszonen innerhalb des Rohrleitungsnetzes führen können. Solche Betriebsbedingungen begünstigen die Vermehrung von Legionellen und stellen Betreiber vor zusätzliche hygienische Anforderungen. In sensiblen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen ist die konsequente Einhaltung dieser Hygieneanforderungen von entscheidender Bedeutung für den sicheren Betrieb.
TGA-Systeme zur Wassereinsparung
An diesem Punkt kommen gebäudetechnische Systeme mit hohem Automatisierungs- und Überwachungspotenzial zum Einsatz. Sie ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Schwachstellen in der Trinkwasserversorgung, unterstützen die Prävention von Leitungs- und Gebäudeschäden und tragen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs bei. Auch wenn ihre Bauform oft unauffällig ist, stellen sie einen zentralen Bestandteil einer effizienten und sicheren Gebäudetechnik dar und gelten als deren „unbesungene Helden“.
Filtration und Druckregelung
Die Filtration des Trinkwassers am Hauswassereingang wird in der Praxis häufig unterschätzt. Mechanische Partikelfilter verhindern, dass Feststoffe wie Sand, Rostpartikel oder abgelöste Ablagerungen aus dem öffentlichen Versorgungsnetz in die Gebäudetechnik eingetragen werden. Dadurch wird der Verschleiß der gesamten Trinkwasser-Installation reduziert und dem Auftreten bestimmter Korrosionsarten vorgebeugt.
In Deutschland gehören mechanisch wirkende Partikelfilter zum technischen Mindeststandard gemäß den geltenden Regelwerken. Ein Beispiel ist der Drufi+ DFR/FR 2315 von SYR. Das System kombiniert einen rückspülbaren Feinfilter mit einem werkseitig auf 4 bar eingestellten Druckminderer. Bei großen Druckdifferenzen innerhalb des Gebäudenetzes können solche Druckregelarmaturen nicht nur die mechanische Belastung der Rohrleitungen und Armaturen reduzieren, sondern auch den Wasserverbrauch optimieren. Die beiden Funktionen sind eine Grundvoraussetzung für eine lange Lebensdauer der Hausinstallation.
Erkennung von Leckagen

Hans Sasserath
Laut dem Gesamtverband der Versicherer (GDV) hatten 2023 Leckageschäden einen Anteil von fast 75 % (über 8,6 Mrd. Euro) am gesamten Schadenaufwand in der Gebäudeversicherung. Gerade in Zeiten wachsender Ressourcensensibilität und bei einem Fokus auf Wirtschaftlichkeit gewinnt die frühzeitige Erkennung von Leckagen mithilfe technischer Lösungen an Bedeutung.
Während Leckageschutz früher überwiegend durch separate Einzelgeräte umgesetzt wurde, erfolgt die Realisierung heute zunehmend in Form multifunktionaler Kombinationssysteme. Ein Beispiel hierfür ist der TRIO DFR/LS Connect 2425 von SYR. Das Gerät vereint einen rückspülbaren Feinfilter, einen Druckminderer und ein automatisiertes Leckageschutzsystem. Die integrierte Sensorik erfasst Betriebsanomalien wie ungewöhnlich hohe Verbrauchsmengen und Fließgeschwindigkeiten sowie ungewöhnlich lange Entnahmezeiten. Darüber hinaus können kleinste Leckagen über spezielle Mikroleckagentests erkannt werden.
Zudem können Feuchtigkeitssensoren wie der SYR SafeFloor an kritischen- und signifikanten Messpunkten im Gebäude platziert werden. Im Ereignisfall wird der Wasseraustritt über SYR Connect an das Leckageschutzgerät gemeldet, welches umgehend die Wasserzufuhr unterbricht. Auf diese Weise lassen sich größere Wasserschäden und unnötige Ressourcenverluste effektiv vermeiden.
Rückflussverhinderung
Auch nicht sichtbare Kontaminationen können indirekt zu erhöhtem Wasserverbrauch führen, wenn beispielsweise verunreinigtes Wasser aus Haushaltsgeräten, Bewässerungsanlagen oder technischen Anlagen in das Trinkwassernetz zurückfließt. Solche Rückflüsse stellen nicht nur ein erhebliches hygienisches Risiko dar, sondern erfordern in vielen Fällen aufwendige Spül- oder Desinfektionsmaßnahmen der gesamten Hausinstallation – mit entsprechend hohem Wasser- und Kostenaufwand.
DIN EN 1717 legt deshalb verbindliche Anforderungen in fünf Flüssigkeitskategorien für den Schutz des Trinkwassers vor Rückfließen, Rückdrücken oder Rücksaugen fest, abhängig vom Gefährdungspotenzial der jeweiligen Wasserart. In der Praxis kommen hierfür unter anderem Systemtrenner, Rückflussverhinderer oder freie Ausläufe zum Einsatz.
Ein häufiger Anwendungsfall ist die Trennung zwischen Trinkwassernetz und Heizungsanlage. In Deutschland gilt z. B. die FüllCombi BA 6628 von SYR als gängige Lösung: sie kombiniert einen Systemtrenner der Bauart BA mit einer integrierten Druckregelung und erfüllt damit gleichzeitig die hygienischen und betriebstechnischen Anforderungen.
Thermische Kontrolle

Hans Sasserath
Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) legt fest, dass Wasserversorgungsanlagen so zu planen und zu errichten sind, dass sie mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen und dass sie mindestens nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu betreiben sind. Daraus resultiert eine für viele Gebäude geltende Anforderung, dass Warmwasser dauerhaft eine Temperatur von über 60 °C und Kaltwasser von unter 25 °C aufweisen muss, um das Wachstum von Legionellen und anderen Mikroorganismen zu verhindern.
Bei einer festgestellten mikrobiologischen Belastung stellt die thermische Desinfektion ein etabliertes Verfahren dar, ist jedoch mit einem hohen Energie- und Wasserverbrauch verbunden. Eine nachhaltige und wirtschaftliche Alternative ist die Prävention durch Vermeidung von Stagnation. Systeme wie die HygBox Connect 2622 von SYR ermöglichen eine automatisierte Kontrolle der Stagnationszeiten und der Temperaturen. Dadurch bleibt das Temperaturniveau innerhalb vorgegebener Grenzen stabil, und der Aufbau von mikrobiologischer Belastung wird durch einen regelmäßigen Wasseraustausch vermieden. Insbesondere in komplexen Liegenschaften wie Hotels, Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern werden so die hygienischen Anforderungen sowie die Spüldokumentation zuverlässig erfüllt – gleichzeitig verhindert die „Intelligenz“ der Armatur einen unnötigen Verbrauch.
Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Trinkwasserhygiene